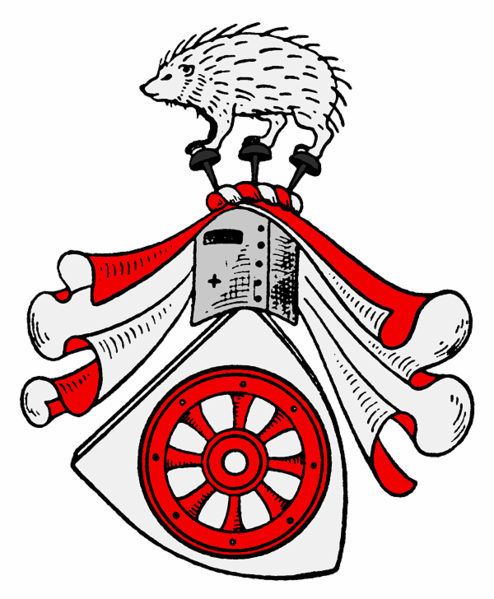Am Beispiel der Frauen in der Familie v. Stülpnagel wird deutlich, wie sehr die Wahrnehmung und damit auch Darstellung der Realität abhängig sind von zeitbedingten Wertungen und ihrer Sprache.
Werner v. Kieckebusch (1887-1975) hatte 1938 auf Bitte des Familienverbandes die Aufgabe übernommen, eine „Geschichte des Geschlechts v. Stülpnagel“ (Erster Band) aufzuschreiben; im Jahre 1957 wurde von ihm eine erste Fortsetzung bearbeitet. 1971 wurde eine zweite und 1986 eine dritte Fortsetzung von Joachim v. Stülpnagel (XIV/265, 1917-2004), dem Schriftführer der Familie von 1949-1993, angefertigt. Alle drei Fortsetzungen fanden 2009 schließlich Eingang in einen Zweiten Band der Geschichte des Geschlechts v. Stülpnagel, für den Karl Heinrich v. Stülpnagel (XV/306, geb. 1960) verantwortlich zeichnete.
Die Chronisten sind männlich – die Familiengeschichte auch?
In einer adeligen Familie, in der der Name allein durch Heirat im Mannesstamme weitergetragen wird, finden Frauen anfangs kaum Eingang in offizielle Urkunden – sie bleiben weithin „unsichtbar“. So werden in den älteren, männlich verfassten Familienchroniken zu den Frauen häufig nur Geburt, Vermählung und Sterbedatum mitgeteilt oder ihre Existenz wird, wenn überhaupt, mit Bedauern bzw. einer gewissen Hilflosigkeit kommentiert. Diese „Vorgehensweise“ schlägt sich z.B. in der quantitativen Textaufteilung nieder und führt bisweilen zu einem Ungleichgewicht in den Lebensbildern.
„Aus Christophs (IV/13, geb. 1504) Ehe sind zwei Kinder bekannt: Joachim und eine Tochter, deren Name nicht genannt wird“ (1938, S. 28).
„Aus Wolffs (VI/31, 1593-1666) erster Ehe stammen drei Kinder: Elisabeth, Joachim Friedrich und Ilsabe Dorothea, während aus der zweiten Ehe nur zwei Töchter hervorgingen: Katharina Sophie und Anna Elisabeth. So war sein Sohn Joachim Friedrich der einzige Stammhalter des Geschlechts.“ (1938, S.44).
„ … aus Alfred von Stülpnagels (XII/129, 1834-1902) Ehe war nur eine Tochter Elisabeth (1867-1912) hervorgegangen.“ (1938, S.141).
Im Lebensbild zu Heinrich von Stülpnagel (XI/89, 1799-1857) zitiert Werner v. Kieckebusch einen Brief, in dem dieser seinem Freund v. Wangenheim seine Sorge mitteilt, seine aus der Pension zurückkehrenden Töchter auf dem Lande unterhalten zu können: „Zu Ostern bekomme ich zwei Töchter von 16 und 17 Jahren zu Hause. Sage einmal, was fange ich mit den Wesen an? In der Stadt, nun ja, da gehen sie in den Anlagen spazieren, zum Kaffee, Thee, in Concerte und belustigen sich trefflich. Aber auf dem Lande!! Den ganzen Winter hindurch gibt’s vielleicht in der benachbarten Stadt (3 Meilen) zwei Bälle, wo, wenn´s Glück gut ist, einmal ein Lieutenant mit ihnen tanzt. Der liebe Gott sollte eigentlich dem Landmann gar keine Töchter bescheeren, sondern nur Söhne!“ (1938, S. 108). Auch wenn die Ausführungen Heinrichs vom Chronisten Werner v. Kieckebusch als Ausdruck eines eigenwilligen Humors kommentiert werden, sind sie doch zugleich ein Hinweis darauf, welche Geringschätzung den Töchtern entweder durch Heinrich selbst und/oder durch den Chronisten und seine Kommentierung zugemessen wird.
Während von Heinrichs (XI/89, 1799-1857) Töchtern Marianne (XII/130, 1836-1873), Helene (XII/131, 1837-1892) und Elisabeth (XII/132, 1840-1895) in jeweils knappen, sechs bis zehn Zeilen umfassenden Beiträgen nur Geburt, Vermählung und Sterbedatum mitgeteilt werden, beschreiben die mehrseitigen Ausführungen zu den Söhnen Alfred (XII/129, 1834-1902), Claus (XII/133, 1843-1907) und Friedrich (XII/134, 1847-1914) umfassend deren Werdegang sowie ihre Leistungen und Verdienste für Familie, Volk und Vaterland (1938, S. 141 ff.)
In seinen Ausführungen zu Ferdinand v. Stülpnagel (XII/124, 1813-1885) und seiner Frau Cäcilie, geb. v. Lossow (1809-1886) „widmet“ der Chronist Werner v. Kieckebusch“ 306 Zeilen dem Mann (Ferdinand), nur fünf Zeilen werden für seine Frau (Cäcilie) verwendet (1938, S.138).
Die Redlichkeit in der Darstellung verlangt zugleich den Hinweis, dass sich in der Familienchronik von 1938 auch ein (!) Beispiel für eine sichtbare Beachtung weiblicher Familienmitglieder findet. Die Art, wie Wolff v. Stülpnagel (VII/31, 1593-1666) in seinem „Zeitbuch“ ausführlich über seine erste Frau Anna v. Holtzendorff (1595-1638) schreibt und die zärtlichen Eintragungen über seine Kinder zeugen von einer Wertschätzung, die Frauen in dieser Zeit (nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges) eher selten entgegengebracht wurde. So schreibt Wolff über seine erste Frau:
„Anno 1595 ist sie gebohren auff Jacoby Tag (= 25.Juli) undt Dir Christo eingeleibet worden. Undt hat ihr der Vater zuschuelet, daß sie fertig schreiben undt lesen können, biß se zu ihren Jahren daß fleißig Haußhalten undt ihre junfferliche Arbeit mit Fleiß verrchtett. Anno 1616 ist auff christliches Anwerben und Radtschlagen Wulff von Stulpenagell zugesagt und den 9.Tach vohr heiligen Weihnachten vertrauwett worden. Mit demselben hatt sie n der Ehe gezeugett 3 Kinder, als einen Sohn undt 2 Tochter. Die 2 hingegen noch Gott Lob am Leben undt de jüngste aber nur 6 Wochen nur gelebett. Anno 1638 den 12. Juli in der Nacht zwischen 12 undt 1 Uhr sanft undt selich von dieser Welt abgeschieden undt den 3.Tach dahrnacht im Kloster in der heiligen Dreifaltikeitt de Begräbnis gekauffet undt dahrin begraben worden, mit die Cereminien, die dahr hat dehrmalen zu haben können.
N.B. Sie ist aber eine tugentsahme und fromme gottselige Frauw gewesen, gehrn zur Kirchen gegangen, offtmals daß hoch wirdige sacramentum gebrauchet.“ (W. v. Kieckebusch 1938, S. 41f.)
Und über die Geburt seiner ersten Tochter Elisabeth (VII/36, 1618-1680) vermerkt Wolff im „Zeitbuch“:
„Anno 1618 den ander (2.) Augusty auff den Schöntach von ungerechten Haußhelter umb 5 Uhr auff den Abendt ist mein liebeß Tochterlein Elisabeth von Stulpenagelß auff dieser Weldt gebohren und ist auch denselben Anbent, weil eß schwach gewesen den Herrn Chrsto zu der heiligen Tauffe einverliebett worden.“ (W. v. Kieckebusch 1938, S. 47).
Wolffs drittem Kinde Ilsabe Dorothea (VII/38, 1632-1633) war nur ein ganz kurzes Leben beschieden. In seinem „Zeitbuch“ schreibt er darüber:
„Mein allerliebste Töchterlein Ilsabe Doertchke S(elig) ist den 30. Januari Anno 1633, hatt Gott der Allmechtige nach seinem veterlichen Willen undt Rat zwischen 12 undt ein Uhr in der Nachtte von dieser müheselichen Welt gahr sanfft und stille abgeforderett unt zhue sch in sein eweges Himmelreiche genommen. Der Sehlen Gott gnedich sein unt ihr sampt allen Auserwehlten am jungsten Tage eine frohliche Aufverstehung verleihen durch unsen Heren Jesum Christum. Amen.“ (v.Kieckebusch 1938, S.50)
In den Fortsetzungsbänden und Nachträgen der Familienchronik verlieren die geschlechtsspezifischen Engführungen in der Sprache langsam, aber zusehends an Bedeutung. Zwar werden noch bis Mitte der 1950er Jahre (!) männliche Lebensbilder zulasten von weiblichen Biographien ausgeführt und verstärken so zunächst weiter das Ungleichgewicht in der Darstellung und Wertschätzung männlicher und weiblicher Namensträger:
Im 1. Fortsetzungsband der Familienchronik von 1957 werden beispielsweise in den Lebensbildern der weiblichen Namensträgerinnen Waltraut (XIV/243, 1917-1977) und Maria (XIV/255, 1918-1975) – mit Ausnahme des Heiratsdatums – ausführlich und wortreich ihre Männer (Wilhelm von Brünneck / Hans Uffenorde) und deren Verdienste beschrieben (1957, S. 15 und 17).
Aber gleichzeitig finden Frauen auch Eingang in die bisher Männern vorbehaltenen Rubriken der Chronik:
Während die Ausführungen zur „Ehrentafel“ in der Familienchronik von 1938 (S. 275 ff.) noch deutlich den Geist und die Sprache des Nationalsozialismus atmen und ausschließlich den Heldentod der männlichen Familienmitglieder im 1. Weltkrieg betrauern, werden in der „Ehrentafel“ im 1. Fortsetzungsband der Familienchronik von 1957 auch Frauen gewürdigt, „die den Heldentod starben oder den Einwirkungen des Krieges zum Opfer fielen“ (S. 2 ff.).
In den Fortsetzungen 2 (1971), 3 (1986) sowie im 2.Band (2009) werden die biographischen Texte nicht mehr von einem männlichen Chronisten allein verfasst, sondern unter Zugrundelegung von Angaben einzelner Familienverbandsmitglieder oder deren Angehörigen zusammengestellt. Diese Vorgehensweise birgt zwar die Gefahr der Subjektivität in sich, und die Endredaktion liegt auch weiterhin in den Händen eines männlichen Familienmitglieds, aber es wird in kleinen Schritten auch erkennbar, dass die Texte der weiblichen Lebensbilder umfassender werden, öfter den Eigenwert der Frau als Individuum thematisieren und zugedachte Rollenerwartungen überschreiten. So werden in der Sprache der Familienchronik die Stülpnagel-Frauen zunehmend „sichtbarer“, ohne jedoch im Sprachgebrauch schon die Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen!